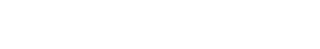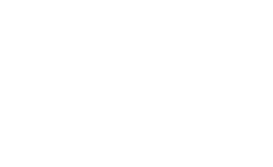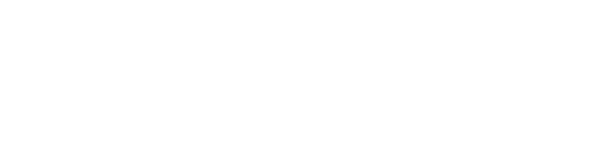In der gesamten Antike gibt es für die Frau einen relativ gleichbleibenden Typus des Gewandes, der sich überregional nur durch wenige Unterschiede auszeichnet. Hauptkleidungsstück ist ein großes Rechteckiges Tuch, das in mehr oder weniger großer Menge am Stück um den Körper drapiert wird. Im frühen Griechenland wird vornehmlich der sogenannte ionische Peplos getragen, ein an einer Seite offenes Rechteck, das einmal oben umgelegt wird und dann mit Nadeln an den Schultern festgesteckt und in der Taille oder unter der Brust gegürtet. Diese Drapierung kennt man auch von der späteren Form des geschlossenen oder dorischen Peplos, der als Grundform einen Schlauch aufweist. Das Kleidungsstück ist vermutlich aus leichter, gefärbter Wolle in Leinwandbindung gefertigt. Gegen Leinen als Material sprechen vor allem Farbstoffrestanalysen von Statuen dieser Zeit und Abbildungen, die kräftige Farben aufweisen, was mittels pflanzlicher Färbung nur sehr schwer und undauerhaft auf Flachsstoffen gelingt. Ob es Unterkleidung gab, ist leider nicht bekannt, angesichts der offenen Trageweise aber unwahrscheinlich. Die Säume sind oft mit deutlich erkennbaren farblich kontrastierenden Besätzen/Borten versehen, die vermutlich eingewebt oder aufgenäht wurden. Aber auch eine Bemalung der Kleidung mit Farbpigmenten ist nicht auszuschließen. Um 400 vor Christus beginnen sich verschiedene weitere Formen herauszubilden, die allgemein unter den Begriff "Chiton" fallen. Damit bezeichnet man ein genähtes Kleidungsstück, das keiner zusätzlichen Nadeln mehr bedarf und reichlich an Stoffmenge abgenommen hat. Der Überschlag (Apoptygma) verschwindet und der zurückbleibende in der Vertikale komplett geschlossene Schlauch, der der Dame seitlich bis an die Hände reicht, wird mit kleinen Stoffknötchen (Vorgänger des angesetzten Knopfes) an mehreren Stellen entlang der Arme verschlossen, so dass Scheinärmel entstehen. Diese Trageweise würde verschiedene Drappierungen und Armlängen erlauben. Im Laufe der Zeit bildet sich die Breite des verwendeten Stoffes immer mehr zurück und man beginnt, die oberen Kanten mit fixen Nähten zu schließen und die seitlichen Kanten wie ein Ärmelloch teilweise offen zu lassen. Für diesen Typus der Kleidung wäre leinerne Unterbekleidung machbar und sinnvoll. Von Sklavendarstellungen kennt man außerdem Kleidungsstücke im Stil einer Tunika, also mit echten, angesetzten Ärmeln, es ist allerdings nur im Ausnahmefall davon auszugehen, dass die griechischen Frauen diesen Typus übernahmen. Über dem Chiton trägt die Dame des 4. Jhdts das sogenannte Himation, eine Art Manteltuch, das wenn nötig den gesamten Körper verhüllen kann. Es wird besonders bei erwachsenen, verheirateten Frauen über Scheitel und Schultern gelegt und verschleiert die Formen des weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit. Auch hier verwendet man vermutlich leichte, gefärbte Wolle mit diversen Verzierungen. Das Himation ist, vergleichbar mit der Palla der späteren römischen Frauen, zugleich Zeichen der Sittlichkeit und des sozialen Standes.
Das Haar trägt sie außer Haus immer hochgesteckt, meist im Nacken oder am Hinterkopf zu einem Haarknoten gedreht und zur Sicherheit werden die Haare rund um das Gesicht mit einem Band, hin und wieder sogar einer Haube/einem Haarnetz zurückgehalten, so dass die Frisur geordnet und sauber drapiert bleibt. Kaum eine Abbildung zeigt frei hängende Haarsträhnen oder gar offenes Haar.
Geschrieben von Agnes Zankl vom Verein Wienische Hantwërcliute 1350.